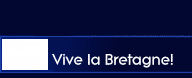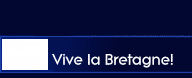| |
|
|
| |
|
Bitte meldet mir kaputte Links!
Da diese Seiten neu erstellt sind, konnte ich noch nicht alles
überprüfen!

|
|
Das Rätsel von Carnac
| Etwa um 3000 vor Christus begann ein
unbekanntes Volk, mächtige Steinmale zu errichten. Man findet sie
zwischen dem Jordanland und den Orkney-Inseln an vielen Küsten -die
meisten in der Bretagne, die rätselhaftesten bei Carnac. |
Carnac-Plage ist ein kleiner,
lebhafter Badeort an der Bucht von Quiberon. Hier, an der bretonischen
Riviera, spürt man schon den Flair des Südens. Pinien stehen
zwischen den Villen und Hotels, am schönen Strand genießen
Tausende die einfachen diesseitigen Freuden eines Urlaubs am Meer.
Wer auf der Avenue des Druides anderthalb Kilometer landeinwärts
führt, begegnet einer ganz anderen Welt Auf einer weiten, stillen
Heidefläche stehen zwischen Stechginsterbüschen Tausende
von Steinen in geordneten Reihen, Marschsäulen einer starren,
stummen Armee.
Es gibt Hunderte von Legenden über die Steine von Carnac. Eine
erzählt der Pfarrer, dessen Kirche dem heiligen Cornély
geweiht ist, dem Schutzpatron der Bretagne: Cornély (Cornelius,
Märtyrertod im Jahre 253), Nachfolger Petri in Rom, habe sich
geweigert, dem Mars zu opfern und sei in die Bretagne geflohen. Als
der römische Kaiser eine Armee ausschickte, um ihn zu fangen,
habe er sie mit seinen Gebeten in Steine verwandelt.
 Aber es ist sicher, daß schon die Legionäre Cäsars
das steinerne Heer bestaunten. Leider ist nicht überliefert,
welche Geschichten ihnen die Gallier darüber erzählten.
Auch als die moderne Wissenschaft ihre Fragen stellte, blieben die
Steine stumm. Was wir bis heute über sie wissen, ist wenig, die
meisten ihrer Rätsel sind noch immer ungelöst.
Aber es ist sicher, daß schon die Legionäre Cäsars
das steinerne Heer bestaunten. Leider ist nicht überliefert,
welche Geschichten ihnen die Gallier darüber erzählten.
Auch als die moderne Wissenschaft ihre Fragen stellte, blieben die
Steine stumm. Was wir bis heute über sie wissen, ist wenig, die
meisten ihrer Rätsel sind noch immer ungelöst.
Gewiß ist, daß weder die Römer und Gallier noch die
Kelten - wie lange angenommen - die Steine gesetzt haben. Es war ein
bis heute unbekanntes Volk, das etwa 3000 Jahre vor Christus, gegen
Ende der Jungsteinzeit, aus dem Zustand der Fraglosigkeit erwachte.
Es fühlte sich nicht mehr geborgen im Schoße der Natur,
durch sein aufbrechendes Bewußtsein vertrieb es sich selbst
aus dem Paradies.
Nur die Sehnsucht, den Tod zu besiegen, dem Leben Dauer zu verleihen,
kann das Motiv gewesen sein, Riesensteine aufzurichten und aufeinanderzutürmen.
Beginnend im östlichen Mittelmeerraum, ziehen sich die Zeugnisse
der Megalithkultur (griechisch megalith heißt großer Stein)
über Malta, Sardinien, England (Stonehenge) bis zur Iberischen
Halbinsel. Besonders viele finden sich in der Bretagne, die rätselhaftesten
bei Carnac.
Aus der bretonischen Sprache stammen auch die Bezeichnungen für
die beiden Grundformen der prähistorischen Denkmäler. Der
aufrecht stehende Einzelstein heißt Menhir (bretonisch ar-men-hir,
langer Stein) und die Form, bei der mehrere Steine mit einer waagerechten
Deckplatte eine Kammer bilden, Dolmen (bretonisch dol-men, Steintisch).
Man nimmt an, daß die Megalithiker ein seefahrendes Volk waren,
denn fast alle Menhire und Dolmen wurden in Sichtweite der Küste
oder doch in unmittelbarer Nähe errichtet. Es gibt mächtige
Menhire, die oft über viele Kilometer an ihren Standort transportiert
wurden. Es muß ein Volk mit einer hochentwickelten Sozialstruktur
gewesen sein, denn einen Riesenmenhir herzurichten und aufzustellen,
erforderte eine hohe technische und organisatorische Leistung. Der
größte ist der Menhir von Locmariaquer, etwa 15 Kilometer
von Carnac entfernt. Etwa um 1700 wurde er vom Blitz getroffen und
liegt heute in vier Teile zerborsten auf der Erde. Aber jahrtausendelang
war er den Seefahrern Ziel und Zeichen. So schrieb der Geograph Scymnos
von Chios im ersten Jahrhundert vor Christus über die Kelten:
»An der äußersten Grenze ihres Landes befindet sich
eine Säule. Sie erhebt sich gegen das Meer vor den stürmischen
Wogen...«
Was der griechische Geograph nicht wußte: Die Steinsäule,
die für ihn das Ende des Reiches der Kelten markierte, war das
Werk eines noch geheimnisvolleren Volkes, das mit seiner Fähigkeit,
Gigantisches zu vollbringen, längst ins Dunkel der Geschichte
zurückgesunken war. Der Menhir von Locmariaquer war über
20 Meter lang, hoch wie ein sechsstöckiges Haus und wog 350 Tonnen.
Wie die Megalithiker diesen Stein behauen, an diese Stelle geschleppt
und aufgerichtet haben, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Zum
Vergleich:
Anno 1556 waren mit der Aufrichtung des Obelisken auf dem Petersplatz
in Rom, der halb so schwer ist wie der Menhir von Locmariaquer, 800
Arbeiter mit 70 Pferden fast ein Jahr lang beschäftigt.
Die Menhire des steinernen Heeres von Carnac sind kleiner. Die ersten
Reihen ragen etwa 60 Zentimeter aus der Erde, jede folgende ist größer,
die letzten vier Meter hohen Kolosse formieren sich zum Kreis, der
Cromlech genannt wird, wahrscheinlich ein Kultplatz, auf dem sich
eine über tausendköpfige Menge versammeln konnte. Von Südwest
nach Nordost gibt es drei dieser riesigen Anlagen mit insgesamt etwa
3000 Steinsetzungen; zusammen sind sie vier Kilometer lang. Die Franzosen
nennen sie einfach alignements, Reihen.
Waren es Friedhöfe? Man hat Gräber gefunden bei den Menhiren,
aber die können jünger sein als die Steine. Opfergaben beweisen,
daß die Menhire ihren Schöpfern heilig waren. Die Dolmen
sind sicherlich Grabkammern. Nicht nur den größten Menhir,
auch den größten Dolmen hinterließen die Megalithiker
bei Locmariaquer: Table des Marchands (Tisch der Händler) wird
er genannt. Was auch immer sie dem unbekannten Volk der Zyklopen bedeutet
haben mögen, kein Nachgeborener konnte sich der Wirkung dieser
Steine entziehen. Das Christentum, das sie zuerst als heidnisch ablehnte,
integrierte die Steinmale nach und nach in seine Glaubenswelt. Der
christianisierte Menhir von St. Duzec bei Port-Blanc an der Nordküste
trägt Passionssymbole aus dem Jahre 1676. Trotzdem haben sich
viele heidnische Vorstellungen und Bräuche bis heute in der Bevölkerung
erhalten, so zum Beispiel der Glaube, daß die Steine zur Fruchtbarkeit
verhelfen. Paare, die sich Kinder wünschen, gehen nachts zum
Menhir von Kerderf und vereinigen sich in seinem magischen Bannkreis.
Vom Menhir von Saint-Cado glaubt man, daß er Frauen fruchtbar
mache, wenn sie ihren Schoß an ihm reiben. Es gibt kein Steinmal,
von dem nicht eine Sage Wunderbares oder Schreckliches zu berichten
weiß.
Aber auch der aufgeklärte Mensch, der die schier endlosen Reihen
des steinernen Heeres von Carnac durchschreitet, wird sich der Wirkung
dieser Stätte, die einem unbekannten, versunkenen Volk einst
heilig war, nicht entziehen können, eine erste Manifestation
des homo sapiens, steinerner Ausdruck seiner Sehnsucht nach Unsterblichkeit.
Gustav Faber
Empfehlenswerte ausführliche Website
über Carnac (auch in Deutsch)
|
|
 |
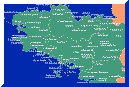
...können schon angeklickt werden.
Zur großen Karte gehts hier...
|
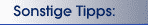 |
Webring Bretagne
Es gibt es auch einen Webring für die Bretagne.
Wenn Du auch eine Seite über die Bretagne hast, dann melde sie hier
an.
Das Wetter in der Bretagne
Hier findest Du das augenblickliche Wetter in verschiedenen Städten.
Such Dir den Ort aus, der Dich interessiert.
hier...
Photos aus und um Erquy
findest Du hier...
Weitere werden folgen.
|
|